Newsletter Juli 2023
Herausgegeben von Bohnet F., Eggler M. und Varin S., mit der Teilnahme von Brückner S.
Mit der Unterstützung von Die Kammer der Fachanwälte SAV im Bau- und Immobilienrecht
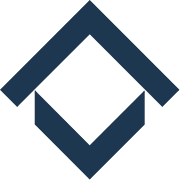
Herausgegeben von Bohnet F., Eggler M. und Varin S., mit der Teilnahme von Brückner S.
Eigentumsgarantie; Politische Rechte und Rechtmässigkeit einer Volksinitiative; Eigentumsgarantie; Art. 26, 36, 74 ff. BV
Politische Rechte und Rechtmäßigkeit einer Volksinitiative – Wiederholung der Grundsätze.
Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) – Die Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) gewährleistet das Eigentum nur in den Schranken, die ihm im öffentlichen Interesse durch die Rechtsordnung gezogen sind. Nach ständiger Rechtsprechung sind namentlich die Anforderungen des Gewässerschutzes (Art. 76 BV), des Umweltschutzes (Art. 74 BV) und der Raumplanung (Art. 75 BV) zu beachten; diese gewichtigen öffentlichen Interessen sind der Gewährleistung des Eigentums grundsätzlich gleichgestellt. Eine Eigentumsbeschränkung, die einer Enteignung gleichkommt und damit eine Entschädigungspflicht wegen materieller Enteignung auslöst, liegt nur ausnahmsweise vor, wenn der Eingriff besonders schwer wiegt oder den Einzelnen ein unzumutbares Sonderopfer abverlangt wird Einzig die sogenannten « wohlerworbenen Rechte » weisen eine erhöhte Rechtsbeständigkeit auch gegenüber nachträglichen Gesetzesänderungen auf.
Im vorliegenden Fall zielen zwei durch kommunale Volksinitiativen vorgeschlagene Regelungen auf die Reduktion von CO2-Emissionen ab. Die wichtigsten Massnahmen sind zum einen die obligatorische Verwendung von Heizungen, die ab 2030 ausschliesslich mit erneuerbaren Energien betrieben werden (Urteil 1C_391/2022), und zum anderen die Verpflichtung, in Wohngebäuden der Gemeinde Kabelschächte zu installieren, die den einfachen Anschluss einer Ladestation für Elektrofahrzeuge ermöglichen (Urteil 1C_392/2022). Nachdem das Bundesgericht eine kommunale Kompetenz zur Gesetzgebung zu diesen Themen anerkannt hatte, prüfte es die Vereinbarkeit der Massnahmen mit der verfassungsmässigen Eigentumsgarantie. Da unbestritten eine gesetzliche Grundlage und ein erhebliches öffentliches Interesse am Erlass dieser Regelungen bestehen, stellt sich lediglich die Frage nach ihrer Verhältnismässigkeit. Gemäss BGer sind diese Massnahmen nicht nur geeignet, um das angestrebte Ziel zu erreichen, sondern beeinträchtigt darüber hinaus nur die finanziellen Interessen der Eigentümer, die relativiert werden müssen, da kantonale Förderbeiträge zur Verfügung stehen. Der zeitliche Spielraum, der den Eigentümern zur Verfügung stünde, um die Änderungen vorzunehmen, erscheint ausreichend, was die Verhältnismässigkeit der Massnahmen stärkt. Somit sind die vorgeschlagenen Regelungen verhältnismässig und somit mit der Verfassung vereinbar : Sie können der Volksabstimmung unterbreitet werden.
NB : Die beiden Urteile sind in der angehängten Datei wiedergegeben (TF 1C_391/2022, dann TF 1C_392/2022).

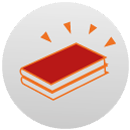

Haftpflicht; Abgrenzung zum öffentlichen Recht; Werkeigentümerhaftung; Art. 41 ff. OR
Abgrenzung zum öffentlichen Recht – Die Haftung der kantonalen und kommunalen öffentlichen Körperschaften richtet sich grundsätzlich nach Art. 41 ff. OR, vorbehaltlich der Annahme von Bestimmungen des kantonalen öffentlichen Rechts durch die Kantone (Art. 59 und 61 OR). Gibt es eine bundesrechtliche Haftungsnorm in einem Spezialgesetz (z.B. Art. 58 SVG) oder unter den Spezialbestimmungen des OR (z.B. Art. 56 und 58 OR ; Art. 679 ZGB), die auch für öffentliche Körperschaften gilt, so geht nach ständiger Rechtsprechung die bundesrechtliche Norm vor und die Kantone können nicht davon abweichen (E. 4.2).
Werkeigentümerhaftung (Art. 58 OR) – Wiederholung der Grundsätze (E. 5.1 und 5.2). Im vorliegenden Fall soll die Errichtung einer Erdaufschüttung unterhalb einer Gemeindestrasse das Chalet des benachbarten Eigentümers beschädigt haben, der daraufhin eine Klage nach der kantonalen Staatshaftung des öffentlichen Rechts einreichte. Nun bestätigt das Bundesgericht, dass eine solche Aufschüttung ein Werk im Sinne von Art. 58 OR darstellt, was keinen Raum für die Anwendung des kantonalen öffentlichen Rechts lässt (E. 5.3). Selbst wenn sich die Aufschüttung auf dem Grundstück eines Dritten befindet, ist es die Gemeinde als Eigentümerin der Straße, die im Sinne von Art. 58 OR dafür verantwortlich ist. Nach der Rechtsprechung ist es nämlich unerheblich, ob die beiden Sachen verschiedenen Eigentümern gehören, wenn zwei rechtlich unabhängige Sachen in funktioneller Hinsicht ein einziges Werk bilden und der Mangel an der weniger wichtigen Sache sich als Mangel an der anderen Sache darstellt. Die Werkeigentümerhaftung des Art. 58 OR trifft dann den Eigentümer des wichtigeren Teils, der das Werk in der Regel als Ganzes errichtet hat, es nutzt, tatsächlich darüber verfügt und daher für seinen Unterhalt sorgen muss (E. 5.4). Folglich bestätigt das Bundesgericht den Unzulässigkeitsentscheid der Vorinstanz.


Werkvertrag; Mangel; Verrechnung; Art. 367 ff. OR; 166 ff. SIA-NOrm
Mangel – Definition und Wiederholung der Grundsätze. Das Werk hat grundsätzlich den technischen Anforderungen und dem Zweck zu entsprechen, zu welchem es der Besteller bestimmt hat. Sofern dieser das Werk einem anderen Zweck widmen will als dies üblich ist, muss er den Unternehmer darauf hinweisen. Diese Pflicht besteht jedoch nicht, wenn der vorgesehene Verwendungszweck üblich ist; in diesem Fall muss das Werk mindestens den anerkannten Regeln der Technik oder einem gleichwertigen Standard entsprechen (E. 4).
Im vorliegenden Fall schloss ein Landwirt einen Werkvertrag über eine Biogasanlage ab. Der für den oberen Ring des Fermenters gewählte Stahl hätte zehn Jahre lang stabil bleiben sollen, litt jedoch nur drei Jahre nach der Inbetriebnahme unter Korrosion. Obwohl dies ein Indiz für das Vorliegen eines Mangels ist, reicht es nicht aus, um die Willkür des vorangehenden Gerichts anzuerkennen, das feststellte, dass es wahrscheinlicher war, dass eine falsche Einstellung des in die Anlage eingeblasenen Sauerstoffs die Ursache für die vorzeitige Korrosion war. Das Bundesgericht betont, dass der Bauunternehmer sicherlich einen anderen, widerstandsfähigeren Stahl hätte vorschlagen müssen, der Besteller jedoch im Verfahren nichts diesbezüglich behauptet hatte (E. 5).



Werkvertrag; Verletzung des Kontrahierungsversprechen; Art. 22, 97 und 377 OR
Verletzung des Versprechens, einen Werkvertrag abzuschliessen (Art. 22 und 97 i.V.m. 377 OR) – Tritt der Versprechende vom Vorvertrag zurück, ist der zu ersetzende Schaden derjenige, den sein Vertragspartner durch die Nichterfüllung des Hauptvertrags selbst, also des Werkvertrags, erleidet. Es gelten die Regeln von Art. 97 in Verbindung mit Art. 377 OR (E. 5)
Da die Bauherren im vorliegenden Fall unter einem reinen Vorwand vom Vertrag zurückgetreten sind, ist der positive Schadenersatz in vollem Umfang geschuldet (E. 5.1). Sie können auf der Grundlage der zuvor eingereichten Kostenvoranschläge bzw. des Entwurfs des Werkvertrags, der letztlich nicht unterzeichnet wurde, ermittelt werden (E. 5.3).

Werkvertrag; Materialien, die auf dem Grundstück eines anderen verwendet werden; Formvorbehalt; absichtliche Täuschung; Art. 671 ff. ZGB; 16 und 28 OR
Materialien, die auf fremdem Grund und Boden verwendet werden (Art. 671 ff. ZGB) – Wiederholung der Grundsätze. Diese Bestimmungen gelten nicht, wenn der Einbau des Materials auf der Grundlage eines Vertrags zwischen dem Eigentümer des Materials und dem Grundeigentümer erfolgte, ebenso wenig wie wenn die Verbindung des Materials mit dem Grundstück von jemandem vorgenommen wurde, der weder Eigentümer des Materials noch Eigentümer des Grundstücks ist (E. 4.2). Ohne Behauptung und Beweis des Unternehmers, dass sein eigenes Material auf fremdem Grund und Boden verwendet wurde und der Eigentümer des Grund und Bodens bereichert wurde, ist die Entschädigung nach Art. 672 ZGB nicht geschuldet (E. 4.4).
Formvorbehalt (Art. 16 OR) – Hatten sich die Parteien für jede Vertragsänderung eine bestimmte Form vorbehalten, nämlich die Schriftform mit der « rechtsgültigen Unterschrift beider Parteien », so ist dieser Formvorbehalt umfassend und gilt gleichermaßen für alle Auftragsänderungen, unabhängig von ihrem Titel. Es wird (widerlegbar) vermutet, dass die Parteien eine Bestellungsänderung nicht vereinbaren wollten, wenn diese Form nicht eingehalten wurde (E. 5.2). Es obliegt der Partei, die diese Vermutung widerlegen will, zu behaupten und zu beweisen, dass die Änderung stillschweigend erfolgte (E. 5.3.2).
Absichtliche Täuschung
(Art. 28 OR) – Wiederholung der Grundsätze (E. 8.2).


Werkvertrag; Anrechnung von Zahlungen bei mehreren Schulden; Teilklage; Art. 86-87 OR; 86 und 150 ZPO
Anrechnung von Zahlungen bei mehreren Schulden (Art. 86 und 87 OR) – Ausführliche Wiederholung der geltenden Regeln (E. 3.1-3.1.4.3). Aus dieser Regelung ergibt sich, dass der Schuldner zwar beweisen muss, dass er die Zahlung geleistet hat, und dass er diesbezüglich die Beweislast für die Tilgung trägt. Die Beweislast für die Forderung, der die Zahlung zuzurechnen ist, trägt er hingegen nur insoweit, als er sich auf eine von Art. 87 OR abweichende Anrechnung beruft. Bestreitet der Gläubiger weder den Erhalt der Zahlungen noch die Tatsache, dass diese zur Deckung aller Schulden ausreichen, muss er nachweisen, dass der Schuldner die gezahlten Beträge bei der Auszahlung anderen als den gerichtlich verfolgten Forderungen zugerechnet hat (Art. 86 Abs. 1 OR) (E. 3-2 bis 3.7).
Teilklage – Das oben Gesagte gilt auch bei einer unechten Teilklage. Auch in deren Rahmen ist nicht nur über die eingeklagten Forderungen selbst, sondern über alle rechtserheblichen umstrittenen Tatsachen Beweis zu führen (Art. 150 ZPO). Soweit der Beschwerdegegner keine Zuordnung seiner unbestrittenen Zahlungen entweder an die eingeklagten Forderungen (in dem Fall wäre die Klage abzuweisen) oder klar an andere als die eingeklagten Forderungen (dann wäre die Anrechnung auf die eingeklagten Ansprüche – soweit keine Verrechnung erklärt wird – unabhängig vom Bestand der weiteren Forderungen ausgeschlossen) vorgenommen hat, wird die Frage, welche Forderungen den Beschwerdeführerinnen gegen den Beschwerdegegner neben den eingeklagten noch zustehen, rechtserheblich. Davon hängt nämlich ab, ob und wenn ja in welchem Ausmass die unstreitig erfolgten Zahlungen, mit denen der Beschwerdegegner die Tilgung der Forderungen behauptet, nach Art. 86 f. OR auf die eingeklagten Forderungen anzurechnen sind. (E. 3.3.4)


Dienstbarkeit; Auslegung einer Dienstbarkeit; Näherbaurecht und öffentliches Recht; Art. 738 ZGB
Auslegung einer Dienstbarkeit (Art. 738 ZGB) – Erinnerung an die Grundsätze (E. 3.3.1-3.3.3).
Näherbaurecht – Der Grundbucheintrag « Näherbaurecht » umfasst das Recht, in einem geringeren als dem gesetzlichen Abstand an die Grenze des Nachbargrundstücks zu bauen, d.h. auf oder unter der Bodenfläche ein Bauwerk zu errichten oder beizubehalten. So muss der Eigentümer des belasteten Grundstücks dulden, dass der Eigentümer des herrschenden Grundstücks auf seinem Grundstück in einem Abstand baut, der geringer ist als der gesetzliche Mindestabstand zur Grenze. Bei einem gegenseitigen Näherbaurecht verpflichten sich die beteiligten Grundeigentümer gegenseitig, ein Gebäude oder einen Gebäudeteil des anderen im Abstandsbereich zu dulden (E. 3.5).
Zusammenhang mit dem öffentlichen Recht – Näherungsbaurechte müssen sich von Anfang an im Rahmen des öffentlich-rechtlich Zulässigen bewegen : Es ist nicht möglich, mit diesem Instrument von den öffentlich-rechtlichen Abstandsregeln abzuweichen (E. 3.6). Für den Fall, dass das öffentliche Recht den beiden benachbarten Eigentümern nicht erlaubt, von der gegenseitigen Dienstbarkeit zu profitieren, vertritt das Bundesgericht, der Lehre zum Thema folgend, die Ansicht, dass der erste Bauherr vom Abstandsprivileg profitiert, während der zweite Bauherr weiter von der Grenze entfernt sein muss, um den Konflikt zwischen dem Recht auf nahes Bauen und den öffentlich-rechtlichen Vorschriften über den Gebäudeabstand zu lösen. Diese Lösung muss in jedem Fall Vorrang haben, wenn weder aus dem Dienstbarkeitsvertrag noch aus den sonstigen Umständen hervorgeht, dass die Vertragsparteien eine Verpflichtung haben, sich im gleichen Verhältnis von der Grenze zu entfernen (E. 3.6.3).

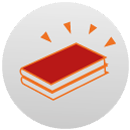
Gesamtarbeitsverträgen; Allgemeinverbindlicher-klärung eines GAV; Art. 1 ff. AVEG
Allgemeinverbindlicherklärung eines GAV (Art. 1 ff. AVEG) – Wiederholung der Grundsätze (E. 4.1 ff.).
Im vorliegenden Fall bestätigte das Bundesgericht die Gültigkeit der von der Tessiner Exekutive beschlossenen Ausweitung des Geltungsbereichs des Gesamtarbeitsvertrags für Ingenieure, Architekten und verwandte Berufe auf kantonaler Ebene

Versicherungsvertrag; Elementarschaden; Kombinierter Schaden; LAIEN/VD
Elementarschaden – Sintflutartige Regenfälle können als von der Versicherung gedecktes Naturelement angesehen werden, auch wenn das Waadtländer Gesetz sie nicht ausdrücklich erwähnt; es ist nicht willkürlich, sie der Kategorie der Überschwemmungen zuzuordnen (E. 5).
Kombinierter Schaden – Gemäß dem Abkommen über Abgrenzung und Regressansprüche, das am 20. Juni 2015 zwischen der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen und dem Schweizerischen Versicherungsverband geschlossen wurde (derzeit ersetzt durch ein überarbeitetes Abkommen vom 1. September 2019), werden Schäden, die durch das gemeinsame Eindringen von Oberflächenwasser (von unten) und Wasser aus dem Erdinneren (Grundwasser, Rückstau aus Kanalisationen) während eines Ereignisses mit derselben meteorologischen Ursache entstehen (kombinierte Schäden), ausschließlich von den kantonalen Versicherungsanstalten übernommen (E. 6).

Bäuerliches Bodenrecht; Widerruf einer Bewilligung zum Erwerb eines landwirtschaftlichen Unternehmens; Beschwerdelegitimation; Art. 61 ff. und 83 BGBB
Bewilligung zum Erwerb eines landwirtschaftlichen Gewerbes (Art. 61 ff. BGBB) – Wiederholung der Grundsätze (E. 5.2.1). Beschwerdelegitimation – Art. 83 Abs. 3 BGBB sieht einerseits vor, dass die Vertragsparteien gegen die Verweigerung der Bewilligung bei der kantonalen Rekursinstanz Beschwerde einlegen können, und andererseits, dass die kantonale Aufsichtsbehörde, der Pächter und die Inhaber des Kaufsrechts, des Vorkaufsrechts oder des Zuteilungsrechts gegen die Erteilung der Bewilligung Beschwerde einlegen können. Obwohl diese Bestimmung nicht abschliessend ist, handelt es sich um eine lex specialis zu Art. 89 BGG, die den Kreis der Personen, die gegen eine Bewilligung Beschwerde einlegen können, einschränken soll (E. 5.2.2). Diese Bestimmung gilt auch für die Beschwerdebefugnis gegen den Widerruf einer Erwerbsbewilligung (E. 5.3 und 5.4). In Anwendung von Art. 83 Abs. 3 BGBB ist der Veräusserer des landwirtschaftlichen Gewerbes nicht zur Beschwerde gegen einen Entscheid berechtigt, der den Widerruf der Bewilligung ablehnt (E. 5.4.2 und 5.5).
NB : das Urteil des BGer 2C_926/2022 vom 13. Juni 2023 befasst sich mit derselben Problematik und übernimmt die Lösung des hier zusammengefassten Urteils

