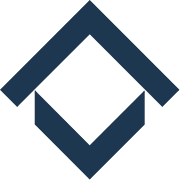BGer 4A_402/2022 vom 31. Januar 2023
Garantien; Auslegung des Vertrages; Abgrenzung zwischen Garantie und Bürgschaft; Art. 18, 111 und 492 ff OR
Auslegung des Vertrages (Art. 18 OR) – Wiederholung der Grundsätze (E. 6.2 und 6.3).
Wenn sich die Bauherrin in einer schriftlichen Vereinbarung « zur Zahlung der Forderung aus Verträgen », die von den Unternehmern unterzeichnet wurden, ohne Beschränkung verpflichtet, kann im Rahmen einer objektivierten Auslegung nicht angenommen werden, dass sie sich nur zur Zahlung der Akontozahlung im Betrag von CHF 100’000.- verpflichtete. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Zweck des Vertrages darin bestand, die Fertigstellung der Arbeiten auf Seiten des Bestellers sicherzustellen, im Gegenzug für eine Sicherheit für sämtliche Forderungen gegenüber einem Dritten, dessen Zahlungsfähigkeit zweifelhaft ist. Ausserdem wurde die Endforderung im Vertrag auf CHF 204’723.20 geschätzt (E. 6.3 und 6.4).
Abgrenzung zwischen der Garantie (Art. 111 OR) und der Bürgschaft (Art. 492 ff. OR) – Merkmale der beiden Verträge (E. 7.1.1). Das vorherrschende Abgrenzungskriterium zwischen den beiden Rechtsinstituten ist die Akzessorietät. Während die Garantie einer unabhängigen Sicherheit entspricht, ist die Bürgschaft akzessorisch, was bedeutet, dass sie das Schicksal der Hauptschuld teilt, indem die akzessorische Verpflichtung von der Hauptschuld abhängig ist und ihr als Nebenrecht folgt (E. 7.1.2). Das Interesse des Promittenten am Geschäft ist ein wichtiges Indiz: Bei einer Bürgschaft fehlt in der Regel ein Eigeninteresse des Bürgen am zu sichernden Geschäft. Sie wird typischerweise zur Sicherstellung einer Verpflichtung von Familienangehörigen oder engen Freunden eingegangen, weshalb sie auch besonderen Formvorschriften unterstellt wurde (E. 7.1.3).
Im vorliegenden Fall ist das Eigeninteresse der Bauherrin, die die Arbeiten an ihrem Gebäude abschliessen wollte, um ein Hotel eröffnen zu können, offensichtlich, was für eine Garantie spricht. Dass die Vereinbarung keinen ausdrücklichen Verzicht auf Einreden und Einwendungen enthält, ändert an dieser Qualifikation nichts, denn ein solcher Verzicht ist in keiner Weise begriffsnotwendig für den Garantievertrag (E. 7.2 und 7.3). Zudem ist es im Gegensatz zur Bürgschaft nicht erforderlich, einen im Garantievertrag bestimmten Höchstbetrag der Haftung zu vereinbaren (E. 7.3.1). Schliesslich ist die Vermutung der Rechtsprechung zugunsten der Bürgschaft im vorliegenden Fall nicht anwendbar, da sie für Privatpersonen gilt und die Bauherrin eine im Immobilienbereich tätige Gesellschaft ist. Diese Vermutung kommt ausserdem nur in Betracht, wenn die Vertragsqualifikation nach dem Vertrauensprinzip nicht zu einem Ergebnis führt, was vorliegend nicht der Fall ist (E. 7.3.2). Der Umstand, dass die Parteien die Vereinbarung als kumulative Schuldübernahme beschrieben haben, hat keinen Einfluss auf die rechtliche Einordnung eines Vertrages, die das Gericht frei prüft (E. 7.3.3).