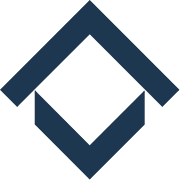BGer 5A_323/2022 vom 27. Oktober 2022
Bauhandwerkerpfandrecht; hinreichende Sicherheit; Art. 839 Abs. 3 ZGB
Hinreichende Sicherheiten (Art. 839 Abs. 3 ZGB) – Der Grundeigentümer kann die provisorische oder definitive Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts verhindern, wenn er eine hinreichende Sicherheit im Sinne von Art. 839 Abs. 3 ZGB leistet. Diese Sicherheit können persönlicher Natur (Bankgarantie, Bürgschaft, andere auf dem Obligationenrecht beruhende Garantie) oder dinglicher Natur (Hinterlegung eines Betrags oder Verpfändung anderer Werte) sein. Um « hinreichend » zu sein, muss die Sicherheit, die durch das Pfandrecht gesicherte Forderung vollständig abdedcken : Sie muss also in qualitativer und quantitativer Hinsicht die gleiche Deckung wie das Bauhandwerkerpfandrecht bieten. In quantitativer Hinsicht bietet das Bauhandwerkerpfandrecht dem Gläubiger Sicherheit für die Kapitalforderung und die Verzugszinsen sowie gegebenenfalls für die Vertragszinsen. Da die Verzugszinsen zeitlich nicht begrenzt sind, hielt das Bundesgericht bis anhin fest, dass die Sicherheiten, die anstelle der Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrecht treten, auch eine unbegrenzte Sicherheit für die Verzugszinsen bieten müssen (vgl. BGE 142 III 738) (E. 3.3 – 3.3.2).
Diese in der Lehre kritisierte Rechtsprechung führte zu einem gesetzgeberischen Revisionsverfahren, das die durch die hinreichende Sicherheit nach Art. 839 Abs. 3 ZGB gedeckten Verzugszinse auf zehn Jahre begrenzt (E. 3.3.2.2). Das Bundesgericht erwof, dass in bestimmten Fällen eine laufende Gesetzesrevision bei der Auslegung einer Norm berücksichtigt werden kann (E. 3.3.3).
Im vorliegenden Fall umfasste der Betrag der von den Eigentümern hinterlegten Sicherheit neben der Kapitalforderung auch die Verzugszinsen über einen Zeitraum von zehn Jahren. Dass sich der Unternehmer vorliegend auf die vorgenannte Rechtsprechung stützte und sich dabei auf die Unzulänglichkeit der hinterlegten Sicherheiten berief, ist gemäss Bundesgericht nicht rechtsmissbräuchlich. Hingegen betrachtete das Bundesgericht den Entscheid der Vorinstanz nicht als willkürlich, in dem sie sich auf das laufende Gesetzgebungsprojekt beziehen, um von der bundesgerichtlichen Rechtsprechung abzuweichen feststellte, dass die Sicherheit, die hier die Forderung des Unternehmers sowie die Verzugszinsen über zehn Jahre deckte, ausreichend waren (E. 3.4).