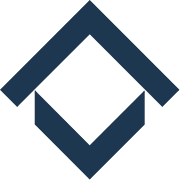BGer 4A_29/2022 vom 19. April 2022
Grundstückkaufvertrag; Grundlagenirrtum; Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 und 26 OR
Grundlagenirrtum - Ein Vertrag ist für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat (Art. 23 OR). Ein solcher liegt namentlich vor, wenn der Irrtum einen bestimmten Sachverhalt betraf, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrages betrachtet wurde (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR). Neben der subjektiven Wesentlichkeit ist erforderlich, dass der zugrunde gelegte Sachverhalt auch objektiv, vom Standpunkt oder nach den Anforderungen des loyalen Geschäftsverkehrs als notwendige Grundlage des Vertrages erscheint. Der Irrtum gemäss Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR kann sich zwar auf eine künftige Tatsache beziehen, jedoch nur, wenn diese Tatsache im Zeitpunkt des Vertragsschlusses objektiv als sicher angesehen werden konnte. Voraussetzung ist weiter, dass die Gegenpartei nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr hätte erkennen müssen, dass die Sicherheit des Eintritts des zukünftigen Ereignisses für die andere Partei Vertragsvoraussetzung war. Wie sich schon aus dem Wortlaut von Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR ergibt, muss sich die Fehlvorstellung auf einen "bestimmten Sachverhalt" ("sur des faits", "una determinata condizione di fatto") beziehen (zum Ganzen: Urteile 4A_92/2021 vom 14. Oktober 2021 E. 3.1; 4A_217/2014 vom 4. August 2014 E. 2.2).
Objektiv wesentlich ist eine falsche Vorstellung, die notwendigerweise beiden Parteien bewusst oder unbewusst gemeinsam und bei objektiver Betrachtung eine unerlässliche Voraussetzung für den Abschluss des Vertrags gewesen ist (E. 2.1).
Fahrlässigkeit - Aus Art. 26 OR lässt sich ableiten, dass ein Grundlagenirrtum im Sinne von Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR auch dann vorliegen kann, wenn der Irrtum auf die Fahrlässigkeit des Irrenden zurückzuführen sein sollte. Durch Fahrlässigkeit wird dem Irrenden eine Berufung auf Grundlagenirrtum demnach grundsätzlich nicht abgeschnitten, sondern sie führt im Allgemeinen nur, aber immerhin, dazu, dass er seiner Gegenseite nach Massgabe von Art. 26 OR Schadenersatz zu leisten hat. Eine Schranke für die Berufung auf Grundlagenirrtum bildet der Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 25 Abs. 1 OR), wobei Treu und Glauben bezüglich des Grundlagenirrtums in Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR noch zusätzlich betont wird. Kümmert sich etwa eine Partei bei Vertragsschluss nicht um die Klärung einer bestimmten, sich offensichtlich stellenden Frage, kann dies bewirken, dass die Gegenseite daraus nach Treu und Glauben den Schluss ziehen darf, der entsprechende Umstand werde vom Partner nicht als notwendige Grundlage des Vertrags betrachtet.
Im vorliegenden Fall ist es nicht ausreichend, sich drei Jahre vor dem Immobilienverkauf über eine mögliche Nutzungsänderung des verkauften Grundstücks zu informieren; eine gewissenhafte Vertragspartei hätte sich vor der Unterzeichnung des Vertrags bei der Gemeinde über die aktuellen und für den Verkauf relevanten Möglichkeiten der Nutzungsänderung erkundigen müssen, um einen Irrtum zu vermeiden. Unter diesen Umständen muss sich der Käufer die fehlende Abklärung als Fahrlässigkeit anrechnen lassen, und sein Irrtum, dass die Umnutzung einer Scheune ausgeschlossen war, muss auf seine mangelnde Sorgfalt zurückgeführt werden. Es handelt sich also um einen fahrlässigen Irrtum im Sinne von Artikel 26 OR (E. 2.5 und 2.6).